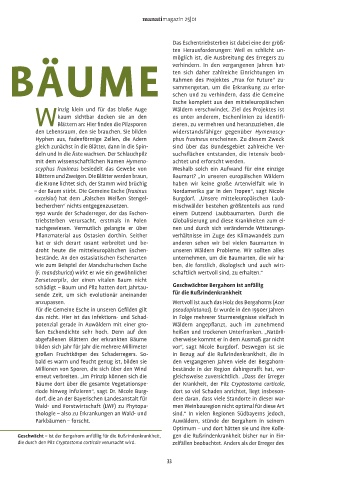Page 33 - manatimagazin_seuchen_25_01
P. 33
manatimagazin 25|01 manatimagazin 25|01
WIE KLEINSTE GEGNER Das Eschentriebsterben ist dabei eine der größ-
ten Herausforderungen: Weil es schlicht un-
möglich ist, die Ausbreitung des Erregers zu
GESTANDENE BÄUME verhindern. In den vergangenen Jahren hat-
ten sich daher zahlreiche Einrichtungen im
Rahmen des Projektes „Frax for Future“ zu-
sammengetan, um die Erkrankung zu erfor-
schen und zu verhindern, dass die Gemeine
Esche komplett aus den mitteleuropäischen
ZU FALL BRINGEN inzig klein und für das bloße Auge Wäldern verschwindet. Ziel des Projektes ist
kaum sichtbar docken sie an den
es unter anderem, Eschenlinien zu identifi-
WBlättern an: Hier finden die Pilzsporen
den Lebensraum, den sie brauchen. Sie bilden zieren, zu vermehren und heranzuziehen, die
widerstandsfähiger gegenüber Hymenoscy-
Schwerpunktthema Seuchen
Hyphen aus, fadenförmige Zellen, die Adern phus fraxineus erscheinen. Zu diesem Zweck
Pilze gehören zu den bisher am besten erforschten Mikroorganismen an gleich zunächst in die Blätter, dann in die Spin- sind über das Bundesgebiet zahlreiche Ver-
Bäumen. Durch die Einschleppung durch den globalen Pflanzenhandel sind deln und in die Äste wachsen. Der Schlauchpilz suchsflächen entstanden, die intensiv beob-
heimische Pflanzenarten mit bisher unbekannten Erregern konfrontiert. mit dem wissenschaftlichen Namen Hymeno- achtet und erforscht werden.
Veränderungen durch den Klimawandel begünstigen deren Verbreitung. scyphus fraxineus besiedelt das Gewebe von Weshalb solch ein Aufwand für eine einzige
Blättern und Zweigen. Die Blätter werden braun, Baumart? „In unseren europäischen Wäldern
Anna Böhm, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Leiterin der Tiergartenkommunikation die Krone lichtet sich, der Stamm wird brüchig haben wir keine große Artenvielfalt wie in
– der Baum stirbt. Die Gemeine Esche (Fraxinus Nordamerika gar in den Tropen“, sagt Nicole
excelsior) hat dem „Falschen Weißen Stengel- Burgdorf. „Unsere mitteleuropäischen Laub-
becherchen“ nichts entgegenzusetzen. mischwälder bestehen größtenteils aus rund
1992 wurde der Schaderreger, der das Eschen- einem Dutzend Laubbaumarten. Durch die
triebsterben verursacht, erstmals in Polen Globalisierung und diese Krankheiten zum ei-
nachgewiesen. Vermutlich gelangte er über nen und durch sich verändernde Witterungs-
Pflanzmaterial aus Ostasien dorthin. Seither verhältnisse im Zuge des Klimawandels zum
hat er sich derart rasant verbreitet und be- anderen sehen wir bei vielen Baumarten in
droht heute die mitteleuropäischen Eschen- unseren Wäldern Probleme. Wir sollten alles
bestände. An den ostasiatischen Eschenarten unternehmen, um die Baumarten, die wir ha-
wie zum Beispiel der Mandschurischen Esche ben, die forstlich, ökologisch und auch wirt-
(F. mandshurica) wirkt er wie ein gewöhnlicher schaftlich wertvoll sind, zu erhalten.“
Zersetzerpilz, der einen vitalen Baum nicht
schädigt – Baum und Pilz hatten dort Jahrtau- Geschwächter Bergahorn ist anfällig
sende Zeit, um sich evolutionär aneinander für die Rußrindenkrankheit
anzupassen. Wertvoll ist auch das Holz des Bergahorns (Acer
Für die Gemeine Esche in unseren Gefilden gilt pseudoplatanus). Er wurde in den 1990er Jahren
das nicht. Hier ist das Infektions- und Schad- in Folge mehrerer Sturmereignisse vielfach in
potenzial gerade in Auwäldern mit einer gro- Wäldern angepflanzt, auch im zunehmend
ßen Eschendichte sehr hoch. Denn auf den heißen und trockenen Unterfranken. „Natürli-
abgefallenen Blättern der erkrankten Bäume cherweise kommt er in dem Ausmaß gar nicht
bilden sich Jahr für Jahr die mehrere Millimeter vor“, sagt Nicole Burgdorf. Deswegen ist sie
großen Fruchtkörper des Schaderregers. So- in Bezug auf die Rußrindenkrankheit, die in
bald es warm und feucht genug ist, bilden sie den vergangenen Jahren viele der Bergahorn-
Millionen von Sporen, die sich über den Wind bestände in der Region dahingerafft hat, ver-
erneut verbreiten. „Im Prinzip können sich die gleichsweise zuversichtlich. „Dass der Erreger
Bäume dort über die gesamte Vegetationspe- der Krankheit, der Pilz Cryptostoma corticale,
riode hinweg infizieren“, sagt Dr. Nicole Burg- dort so viel Schaden anrichtet, liegt insbeson-
dorf, die an der Bayerischen Landesanstalt für dere daran, dass viele Standorte in dieser war-
Wald- und Forstwirtschaft (LWF) zu Phytopa- men Weinbauregion nicht optimal für diese Art
thologie – also zu Erkrankungen an Wald- und sind.“ In vielen Regionen Südbayerns jedoch,
Parkbäumen – forscht. Auwäldern, stünde der Bergahorn in seinem
Optimum – und dort hätten sie und ihre Kolle-
Geschwächt – Ist der Bergahorn anfällig für die Rußrindenkrankheit, gen die Rußrindenkrankheit bisher nur in Ein-
die durch den Pilz Cryptostoma corticale verursacht wird. zelfällen beobachtet. Anders als der Erreger des
32 33